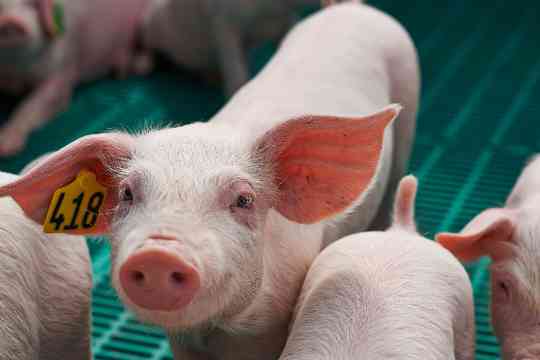
© Quelle: BMLRT, Fotograf:Alexander Haiden
Optizucht Sau Ferkel: Entwicklung, Erfassung, Validierung und züchterische Optimierung ausgewählter funktionaler Merkmale bei Muttersauen und Ferkel in Österreich
Projektleitung
Christina Pfeiffer
Forschungseinrichtung
Universität für Bodenkultur Wien
Projektnummer
101165Projektlaufzeit
-
Finanzierungspartner
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft| Verband österreichischer Schweinebauern| Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus| Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus
Allgemeine Projektinformationen
Abstract (deutsch)
Schlagwörter (deutsch)
Schweinezucht, Ferkelvitalität, Muttereigenschaften, Zuchtplanung, Verhalten
Titel (englisch)
Development, recording, validation and optimization of long-term genetic progress of selected functional traits of sows and piglets of Austria
Abstract (englisch)
All the results (definition and recording of maternal abilities, genetic parameters, genomic information, etc. ) will be included into routine genetic evaluation to genetically optimize the Austrian pig population, to increase animal welfare and to meet farmers economic demands.
Projektziele
1. Durch gemeinsames Erarbeiten von ZüchterInnen, Zuchtwarten, Mitglieder von Zuchtverbänden sowie WissenschaftlerInnen sollen geeignete Merkmale, die mütterliches Verhalten beschreiben, definiert werden. Dazu sollen Workshops und anschließend Schulungen und Beobachterabgleiche für beteiligte Personen veranstaltet werden.
2. Ziel ist die Findung und Validierung von direkten maternalen Merkmalen rund um die Geburt, die eine Vorhersage über gutes maternales Verhalten ermöglichen (z.B. Abliegeverhalten, Nestbauverhalten, Handlingmerkmale).
3. Diese Merkmale sollen in Zukunft einfach und valide unter Praxisbedingungen vom Landwirt/In selbst erfasst werden können.
4. Der Einfluss der erfassten direkten maternalen Merkmale auf die Ferkelüberlebensraten wird überprüft. Dazu ist die detaillierte Erfassung von Ferkelverlusten notwendig. Bei ausreichender Datengrundlage können für dieses Merkmal genetische Parameter geschätzt werden und auf lange Sicht kann dieses Merkmal auch züchterisch bearbeitet werden.
Arbeitspaket 2 (AP2): Beurteilung der Bewegungsfähigkeit der Muttersau
1. Die Erstellung eines Beurteilungsschemas bezüglich Exterieur - Bewegungsfähigkeit - Lahmheit der Muttersau.
2. Die Überprüfung der Beurteilung des Exterieurs bzw. Bewegungsfähigkeit am 180. Lebenstag der Jungsau (Zeitpunkt der Selektion) mit einem späteren definierten Zeitpunkt (nach dem Absetzen des ersten Wurfes (rund 330 Tage)).
3. Der Einfluss der Exterieur - Bewegungsfähigkeit - Lahmheit auf die Ferkelverluste durch Erdrücken wird überprüft. Bei ausreichender Datengrundlage können für dieses Merkmal genetische Parameter geschätzt werden und auf lange Sicht kann dieses Merkmal auch züchterisch bearbeitet werden
Arbeitspaket 3 (AP3): Ferkel- und Wurfbonitur
1. Erhebung von Einzelferkelgewichten bei der Geburt und beim Absetzen, Ferkel unter 1 kg Geburtsgewicht, gesamtes Wurfgewicht bei Geburt und Absetzen; Anzahl gesamt geborener Ferkel, Anzahl lebend geborener Ferkel, Anzahl tot geborener Ferkel, Anzahl mumifizierte Ferkel, Ferkelverluste durch erdrücken, verhungern, sonstiges. Die Einzelferkelwiegung wird ein Jahr durchgeführt.
2. Schätzung von Heritabilitäten, phänotypischen und genetischen Korrelationen der in Punkt 1 genannten Merkmale sowie für die Streuung der Geburtsgewichte.
3. Schätzung von phänotypischen und genetischen Korrelationen zu anderen bereits bestehenden Merkmalen im Gesamtzuchtwert von Mutterlinien.
4. Vereinfachte Wurfbonitur durch den/die Landwirt/In im Hinblick auf folgende Parameter: Wurfausgeglichenheit, Schätzung Anzahl Ferkel unter 1 kg, Schätzung gesamtes Wurfgewicht bei Geburt und beim Absetzen, Ferkelvitalität. Die Wurfbonitierung durch die ZüchterInnen soll zwei Jahre durchgeführt werden.
5. Schätzung von Heritabilitäten, phänotypischen sowie genetischen Korrelationen der Merkmale in Punkt 4.
6. Überprüfung der Übereinstimmung der genetischen Parameter von Punkt 2 und Punkt 4.
7. Bei entsprechend positivem Ausgang von 2 bis 6, Implementierung neuer Merkmale in die Zuchtwertschätzung bzw. eines neuen Merkmales bzgl. Ferkelvitalität (Ferkelvitalitätsindex) in den Gesamtzuchtwert.
8. Vorarbeiten für die Einführung einer routinemäßigen Feldleistungsprüfung zur Erhebung der Ferkelvitalität anhand der Ergebnisse aus Punkt 2 bis 6.
Arbeitspaket 4 (AP4): Zuchtplanung der Reinzuchtlinien Edelschwein und Landrasse
1. Erstmalige Durchführung von Zuchtplanungsrechnungen für die Mutterrassen Edelschwein und Landrasse.
2. Anpassung der Computersoftware ZPLAN.
3. Evaluierung verschiedener Szenarien bezüglich eines erweiterten Zuchtziels (Auswirkung der Einführung neuer Merkmale (aus AP3) auf den Gesamtzuchtwert).
Arbeitspaket 5 (AP): Genotypisierung der Sauen
1. Ziel der Genotypisierung ist die Identifizierung von Genen, die an der Ausprägung von direkten und indirekten maternalen Fähigkeiten, die die Überlebensfähigkeit der Ferkel beeinflussen, beteiligt sind.
2. Ein weiteres projektübergreifendes Ziel der Genotypisierung der Sauen ist die Bereitstellung von genomischer Information für die Erweiterung der Kalibrierungsstichprobe. Zudem kann anhand der genomischen Information ein wesentlicher Beitrag zur Weiterentwicklung der genomischen Selektion sowie der genomisch optimierten Zuchtwertschätzung getätigt werden.
Praxisrelevanz
Zuchtziele mussten sich immer schon gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen. Stand früher die große Nachfrage an tierischen Produkten im Vordergrund, so wird in letzter Zeit verstärkt die Berücksichtigung ethischer Aspekte von der Gesellschaft eingefordert. Die Verbraucher verlangen zunehmend die Verbesserung der Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelqualität. Dafür sind gesunde und vitale Tiere die Basis. Die Umsetzung dieser gesellschaftlichen Forderungen bedeutet nicht nur eine nationale Positionierung der österreichischen Schweinezucht gegenüber Konsument/Innen, sondern es werden auch Zuchttiere erzeugt, die unter zukünftigen Produktionsbedingungen (beeinflusst durch z.B. Konsumentensensibilität; Tierschutzgesetze; Veränderungen von Haltungssystemen; Tierschutzlabel) international wettbewerbsfähiger sein werden.
Forstwirtschaft/Wasserwirtschaft/Umwelt: -
Tierschutz und Ethik:
In den letzten Jahren sind immer wieder Tierschutzthemen insbesondere in Zusammenhang mit den Haltungsbedingungen (z.B. Kastenstand, Einstreu, Beschäftigungsmaterial) diskutiert worden. Seit nicht allzu langer Zeit wird vor allem aber ‚der Tierzucht‘ immer mehr Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit Tierschutzthemen (z.B. „Wegzüchtung“ von Normalverhalten, kurze Nutzungsdauer, überzogene Leistungsniveaus, gesundheitliche Probleme) geschenkt. Die Stichworte reichen dabei von ‚Zielkonflikten in der Tierzucht‘ bis hin zu ‚Qualzucht bei Nutztieren‘. Durch eine Überarbeitung der Zuchtziele und die gezielte Einführung von Merkmalen, die die Fitness und die damit in Zusammenhang stehende Tiergesundheit und das Tierwohl fördern, kann seitens der Zucht ein großer Beitrag zum Tierschutz geleistet werden.